laut.de-Kritik
Sex, Party und Suff in Castrop-Rauxel.
Review von Kai Butterweck"I want sex, i want cars, want the drugs, grab the stars. Take the money, ride my cock, I fucked Jenny from the block": Wer nun allerdings denkt, das wären die ersten Rhyme-Versuche eines desillusionierten L.A.-Checkers, der täuscht sich. Das ist Lyrik aus Castrop-Rauxel, ob mans glaubt, oder nicht.
Frei nach dem Motto: Bekämpfe Langeweile mit Extremen, machen sich sechs Twens unter dem Namen Eskimo Callboy auf, der Welt zu zeigen, was passiert, wenn ein vermeintlich kreativ einschränkendes Umfeld auf explosiven Tatendrang trifft. So etwas kann unter Umständen Großes zu Tage fördern, keine Frage. Im Falle von Eskimo Callboy geht der Schuss allerdings derbe nach hinten los.
Warum? Ganz einfach: Die Attitüde "man sollte uns und unsere Texte nicht allzu ernst nehmen" ist ja schön und gut und sorgt vielleicht bei dem einen oder anderen bereits im Vorfeld für Bonuspunkte, wenn es um die Sympathiewertung geht. Aber man kann es auch übertreiben. Und das tun die Mannen aus den Tiefen des Westens unserer Republik vom ersten bis zum letzten Ton ihres Debüts "Bury Me In Vegas".
Dabei sprechen bereits Songtitel wie "Internude", "Wonderbra Boulevard", "5$ Bitchcore" oder "Transilvanian Cunthunger" Bände. Pubertäre Sex-, Party- und Suff-Erlebnisse bilden das inhaltliche Fundament, das sich in einem nicht minder überflüssigen und chaotischen musikalischen Background suhlt. Hier fährt der Metalcore-Maniac mit der Eurodance-Barbie Achterbahn, ehe man händchenhaltend im elterlichen Eigenheim zwischen Marshall-Amp, Nintendo-Konsole, Alcopops und erregten Genitalien zum gemeinsamen Magenentleeren ansetzt.
Die Idee, die traute Herkunft vom weltbildlichen Klischee-Denken zu befreien und zu beweisen, dass auch zwischen Zeche und Seniorenheim Kreatives und Innovatives möglich ist, ist ohne Zweifel lobenswert. Dazu braucht es aber etwas mehr als strukturloses Core-Gebolze im Verbund mit eingestreuten Pop- und Dance-Elementen.
The Dome- und Wacken-Klänge in Einklang zu bringen ist eine Herausforderung, der selbst etablierte Genre-Kollegen wie Enter Shikari nicht durchgehend gewachsen sind. Eskimo Callboy scheitern jedoch auf ganzer Linie.
Das liegt aber weniger am fehlenden spielerischen Know-How, sondern vielmehr daran, dass die Jungs einfach nicht wissen, wann das Maß voll ist. Jeder einzelne Song ist dermaßen vollgestopft mit Kontrast-Input, dass jeglicher Ansatz von Homogenität bereits im Keim erstickt wird.
Auf einzelne Ergüsse analytisch näher einzugehen, macht wenig Sinn, denn eigentlich besteht das Album nur aus einem einzigen Song. Insgesamt elf Mal drehen sich gängige Metalcore-Riffs um wahllos eingefügte Effekt-Spielereien, während sich Bravo-Pop-Gepiepse mit Death Metal-Growls duellieren. Wenn sich dann auch noch Erika Bergers Enkel, Jimmy Pop Ali und die 10. Klasse der Rütli-Schule zum Austausch von Wochenend-Erfahrungen treffen, geht endgültig das Licht aus. Armes Castrop-Rauxel.




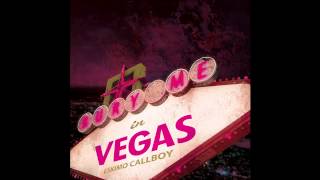



![Eskimo Callboy - Muffin Purper-Gurk [Official Video]](https://i.ytimg.com/vi/KFh0yxw-aVE/mqdefault.jpg)





4 Kommentare
Ich weiß nicht in kleinen Schüben kann die Mucke durchaus Spaß machen, auf Dauer nervt die Attitüde aber wirklich. Handwerklich ist es nicht übel. Leider haben sie ihr Katy Perry Cover nicht mit raufgepackt
Wer mit komplexen Songs nicht zurecht kommt, der kann doch auch einfach weiter Volkslieder hören.
hihi ich liebe texte, die einfach wunderbar böse vernichtend sind.
ich liebe texte, die einfach wunderbar böse vernichtend sind.
10 points, meine verspätung ist mir übrigens bewusst.
die typen erinnern mich an einen schlechten mix
aus rage against the machine, marilyn manson und dann könnten wir ja noch ein bisschen growling mit einpflegen,
damit es aber mal so richtig richtig böse klingt. oh yeah.
mit "text" meinte ich die rezension, nicht die texte von
den callboys ;-p