laut.de-Kritik
Emotionale Ausnahmezustände und feministische Wut.
Review von Hannes Huß"I'm Fine" beginnt mit einer gigantischen Lüge. "Mir geht's gut" proklamiert Christin Nichols beinahe überzeugend. Dazu legt sie astreinen 80s New Wave-Pop auf. Die Gitarre drängt den Song nach vorne, verliert sich stellenweise in sich selbst. Der Bass wummert im Einklang mit dem Schlagzeug. Aber eigentlich ist hier nichts "fine". Niemand, der "fine" ist, plant den Umzug nach Vermont, oder wäscht seine blutenden Haut mit Wein. Nein, hier herrscht Ausnahmezustand. Wer will es ihr da verdenken, dass sie auf andere, gewalttätige Antworten kommt?
"Today I Choose Violence" hat genug vom Wegschauen und höflich drüber lachen. Nichols schaut einfach mal in ihr Umfeld, was da alles so über Frauen gesagt wird. Dabei geht es gar nicht um Ewiggestrige Frauenhasser, die sich alle Frauen zurück an den Herd wünschen. Ne, Christin Nichols wohnt in Berlin inmitten von Künstler*innen. Aber auch in selbsterklärt progressiven Freundeskreisen gibt es internalisierte sexistische Strukturen, die sich in Sprüchen abbilden, die vielleicht gut gemeint sind, am Ende aber aus genau dieser Stammtisch-Mentalität entstammen, die hier ja eigentlich nicht vorherrschen soll. "Du musst an deinem Körper arbeiten, besonders an deinen Beinen" und ein weiteres Worst Of der Trangressionen stößt Nichols angepisst aus sich heraus.
Dazu wummert der Bass ein bisschen wie bei ihrem vorherigen Electropunk-Projekt Prada Meinhoff. Nur im Refrain löst Nichols sich aus der Lethargie des frauenfeindlichen Alltags, um knurrend zu antworten: "Today I choose violence". Aus diesen Electropunk-Anleihen entwickelt sich auch "Malibu" langsam heraus. Lange flirrt hier der Beat, nur langsam legt sich die Gitarre darüber. Dadurch wird aus einer behutsamen 90er-Kindheitserinnerung ein beiläufiger, großartiger Moment der New Wave-Pop-Melancholie.
In der sanften Motivationslyrik von "Take A Risk" findet der Refrain zu einem ähnlich gigantomanischen Popmoment. "Die Welt dreht sich doch immer weiter / geht's mal ein bisschen leichter / mein Schatz? / so take a risk / geh rein da / und das ganze bitte zeitnah" wird mit unglaublicher Verve vorgetragen. Nichols zieht die Zeilen in die Länge und bellt zackige Kommandos, bis wir an ihren Lippen hängen. Dazu kontrastiert sie ihren hypnotischen New Wave-Pop mit monotoner Elektronik in den Strophen und fertig ist sie, die zärtliche, umwerfende Umarmung an all jene, die einfach nur einen kleinen Schubser gebraucht haben.
Auch "Phoenix" wendet sich an all jene, die ein helfende Hand brauchen können. Gedämpft steigt Nichols ein, die Gitarre scheint unter einem gefrorenen See zu lauern und flirtet mit Dissonanz. Hier ist viel Raum, der schnell durchdrungen wird. Jetzt zirkuliert ein Gitarrenriff, das Schlagzeug wird druckvoller, Nichols singt von depressiven Zuständen und Ermutigungen. Textlich ist sie auf höchstem Niveau: "Wenn hier noch einer für was brennt / dann das Feuer für die Parisienne" ist großes Pop-Songwriting voller Nonchalance, Detailfülle und Wärme. Sie hofft auf ihren Wiederaufstieg, wie der "Phönix aus der Asche"
So gerne sich Nichols auf britische alternative Poptraditionen bezieht, auch die deutsche Pop-Progression hat Spuren an ihr hinterlassen, lebt sie doch immerhin seit Kindheitstagen in der Bundesrepublik. "Sieben Euro Vier" blinkt zu Beginn in Richtung Wir Sind Helden auf "Denkmal", bis Nichols' Dadaismus-Sadness und Misantrophie wahnsinnig an Fritzi Ernst erinnern. "Ich möchte, dass es euch schlecht geht / so richtig schlecht geht / so schlecht wie mir" jault sie, voller Agonie und Weltekel. Dazu klingt die Gitarre wunderbar schief und eklig, das Schlagzeug nüchtern-pflichtbeflissen.
Dass dieser bunte Stilmix aufgeht, ist sicherlich auch dem Team um Christin Nichols herum zu verdanken. Denn das hat es wirklich in sich. Simeon Cöster von Isolation Berlin, Martin Steer von Frittenbude, Meghan Wright von Shybits und noch einige andere arbeiten kräftig mit. Aus dieser Vielzahl der musikalischen Herangehensweisen erwachsen Powerrock-Nummern wie das Berühmtheits-fixierte "Fame", das flackernde "Neon" oder die etwas schlappe Düster Wave-Nummer "I See You". Alles hat hier Hand und Fuß, auch wenn daran die Kohäsion des Albums stellenweise leidet.
Doch ganz zum Schluss ist das vollkommen egal. Denn "Bielefeld" ist der absolute Wahnsinn. Vollkommen atemberaubend. Ein Fanal der Einsamkeit. Ein unsterbliches Stück Musik. Es scheint vollkommen wahnwitzig, dass Christin Nichols einer Stadt, die bundesweit nur als sehr schlechter Witz bekannt ist, so ein Denkmal setzen kann. Die "Endstation Bielefeld" ist eine Feier des Lebens, des Nichtsterbens, der überlebten Krisen. Als Schutzheilige über diesem Stück grimmigem Post Punk mit Grungeanleihen schweben weder Robert Smith noch Kurt Cobain. Es ist Alanis Morisette mit ihrem berüchtigten: "Isn't it ironic?". Hier, im DB-Bordbistro kurz vor Bielefeld reißen Obi-Stricke, zerfallen billige Taschenmesser und schmeckt sogar Zugbier. Denn hier ist Heimat, was auch immer das ein soll. Und hier, in der klaustrophobischen Enge von Suizidgedanken und Lebensbejahung ist "I'm Fine" endgültig eine Lüge.


![Christin Nichols - I'm Fine [Official Video]](https://i.ytimg.com/vi/IV8CQSeS_o4/mqdefault.jpg)
![Christin Nichols - Sieben Euro Vier [Official Video]](https://i.ytimg.com/vi/hY2hCSz8nsw/mqdefault.jpg)
![Christin Nichols - Neon [Official Video]](https://i.ytimg.com/vi/oMJLaWIWKME/mqdefault.jpg)
![Christin Nichols - Malibu [Official Video]](https://i.ytimg.com/vi/7gpdVRf801g/mqdefault.jpg)
![Christin Nichols - Today I Choose Violence [Official Video]](https://i.ytimg.com/vi/uugt46LfyXY/mqdefault.jpg)






![Christin Nichols - Citalopram [Official Video]](https://i.ytimg.com/vi/3HpnIAvpuFk/mqdefault.jpg)






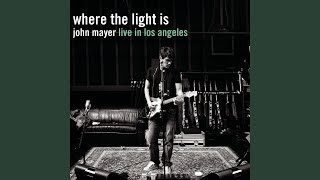
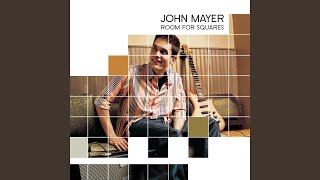

1 Kommentar
WOW!
Sehr schönes Indie/Rock/Electro Album.
Unerwartet Gut.