laut.de-Kritik
Wehe, du klopfst!
Review von Lisa RupprechtJedes Mal, wenn Tyler, The Creator ein neues Album raushaut, fange ich automatisch an zu schwitzen. Was will er mir diesmal sagen? Dieses Gefühl, wenn man weiß, gleich kommt was Großes. Genau das macht Tyler aus und, Überraschung, er enttäuscht nie.
In den letzten Jahren entwickelte sich der US-Rapper zu einer der faszinierendsten Figuren der Musiklandschaft; ein Multitalent, das Design, Film und visuelle Kunst mit Hip-Hop zu einer eigenen Welt verschmilzt. Vor allem beweist Tyler immer wieder, dass er ein Meister darin ist, sich neu zu erfinden.
"Don't Tap The Glass" wirkt auf den ersten Blick wie das genaue Gegenteil des letztjährigen Albums "Chromakopia", einem intensiven Storytelling-Trip durch seine Psyche, die die Bereiche Vaterlosigkeit, Ruhm und Schattenseiten des Erfolgs streifte.
Die neuen Songs sind deutlich leichter und weniger tiefgründig; ein Stilmittel, das leicht den Eindruck vermitteln kann, Tyler setze hier eher auf "Party-Soundtrack" statt auf inhaltliche Weiterentwicklung. Mit 28 Minuten Laufzeit ist das Album kürzer geraten, und vor allem eine Einladung, sich einfach zu bewegen. Man kommt easy rein, ist sofort drin und zack, schon wieder draußen. Kaum hat man sich eingegroovt, ist das Album vorbei. Das passt zum Konzept: schnell, verspielt, leichtfüßig. Aber irgendwie wünscht man sich trotzdem mehr. Mehr Tiefe, mehr Songs, mehr Zeit mit diesem Vibe und auch mehr Stimmen.
Denn auf Features verzichtet Tyler diesmal fast komplett. Ein überraschender Schritt, da gerade die Wechselspiele mit anderen Stimmen seiner Musik in der Vergangenheit oft zusätzliche Dynamik und neue Perspektiven verliehen haben. Der Titel "Don't Tap The Glass" ist eine Metapher, die man von Zoo- oder Aquarium-Besuchen kennt, die hier clever gewählt wurde. Es geht darum, den kreativen Prozess nicht zu stören, Dinge sich entwickeln zu lassen, ohne Angst vor Beobachtung oder Bewertung. Gerade in einer Zeit, in der Tyler das Thema "Angst vor dem öffentlichen Bild" explizit anspricht, wirkt das Album wie ein Statement gegen das erstarrte digitale Ich, das sich hinter Likes und Kommentaren versteckt.
Passend dazu ging sein Release-Konzert komplett ohne Handys über die Bühne: kein Filmen, kein Posten, einfach nur Musik und das gemeinsame Erleben im Hier und Jetzt. Dieses bewusste Handyverbot unterstreicht die Botschaft des Albums: mehr Präsenz, mehr Freiheit, weniger digitale Kontrolle.
Der Opener "Big Poe" startet mit einem Sample aus "Roked" von Shye Ben Tzur – "Roked" heißt auf Hebräisch "tanzen". Ein cooler Einstieg, der direkt Stimmung macht. "Big Poe" ist Tylers neuester Charakter. Der Track ist spielerisch und zeigt Tyler von seiner entspannten, charismatischen Seite. Als Unterstützung fungiert Pharrell Williams, dessen Einfluss man im Verlauf des Albums immer wieder spürt.
Musikalisch greift er auf dem Projekt stark auf seine Wurzeln zurück: Der Sound ist tanzbar, funky, mit viel Groove und Beats, die teilweise an die frühen 2000er erinnern – R'n'B- und Hip-Hop-Referenzen à la Timbaland interpretiert er, ohne nostalgisch zu wirken. Tracks wie "Sugar On My Tongue" bringen dich mit ihren eingängigen, aber trotzdem smarten Beats direkt zum Nicken. Das Spielen mit Wiederholungen, Layering und großen Rhythmen macht das Album zugänglich und trotzdem besonders.
Das merkt man vor allem bei den instrumentalen Details von "Sucka Free" oder "Mommanem", wo sich jede Menge Sounds überlagern und so ein luftiges, lebendiges Klangbild entsteht. Auch die Lyrics sind wie gewohnt mit viel Witz und Selbstbewusstsein geschrieben. Tyler thematisiert auf subtile Weise die Ambivalenz von Ruhm und Freiheit, die Angst vor öffentlicher Beobachtung und die Sehnsucht nach echter Verbindung. "Fuck the high road, I ain't tryna shakе no hands" auf "Mommanem" oder gerade in Songs wie "Stop Playing With Me" oder "Ring Ring Ring" spürt man dieses Spiel mit Gegensätzen: Funky Dance-Beats treffen auf fast bedrohliche Basslines, eine Stimmung, die zwischen verspielt und ernst changiert.
Dieses Album ist eine Einladung, die Kontrolle loszulassen, sich von Erwartungen zu befreien und einfach zu tanzen, ganz ohne Druck und mit einem Augenzwinkern. "Don't Tap The Glass" will man laut hören und dabei den Körper spüren. Es ist kein Konzeptalbum mit tiefschürfender Erzählung, sondern ein Statement der Lebensfreude nach schweren, introspektiven Jahren.


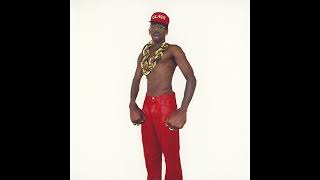

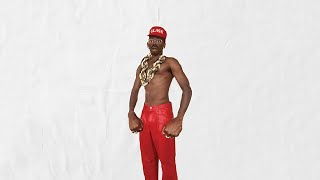




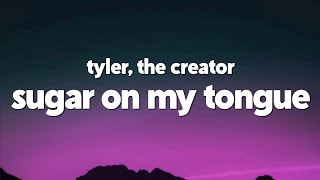



2 Kommentare
Es hat mich leider nicht wirklich abgeholt. Ich hatte jetzt meine ersten beiden Listening-Sessions über Kopfhörer und zunächst fiel mir eher das Mixing auf. Im ersten Song sind schonmal die Zisch-Laute noch so laut, das mir fast das Trommelfell geplatzt ist. Da muss wirklich noch was gemacht werden. Ansonsten werden sehr viele Tracks durch die bassigen Kickdrums sehr matschig. Ich dachte erst, dass es über Boxen einen anderen Effekt hat, schließlich sagt er selbst, dass dieses Album zum abdancen gedacht sei. Aber über Boxen ist es - jetzt, wo ich es gerade höre - teilweise noch schlimmer.
Ich sehe da weniger die 2000er-Referenzen als Ideen von 80er-Jahre Hip-Hop inklusive Miami Bass, was ja auch durch Tylers neu entwickelten visuellen Stil angedeutet wird.
Ein anderes Ding ist eben auch die ideologische Komponente hinter der Idee. Einerseits ist es zu loben, dass Tyler den Musikpurismus für sich entdeckt hat und will, dass Menschen Musik wieder genießen statt als Prestige-Mittel zur Aufwertung des eigenen Status abzufilmen. Die Listening Partys ohne Handy klingen nach einer Menge Spaß. Nur ist für mich die Frage, ob ein 28-minütiges Album mit vielen 2-minütigen Songs eine angemessene Antwort auf die aktuelle Lage des Musikkonsums ist.
Er selber bedient sich ja auch an Sounds und Strukturen des Disko-Genres, dessen Songs auch gerne mal die 5-Minuten-Marke überschritten haben und anstelle weiterer kompositorischer Kniffe einfach mal einen weiteren Refrain hinten drangehängt haben, damit die Leute länger tanzen können. Auch in der aktuellen Musik äußert sich mit dem Aufstieg von EDM der Wunsch nach längeren, tanzbaren Tracks. Manche Goa oder Technosongs sind gerne mal 7-8 Minuten lang. Warum nicht dort die Referenzen setzen? Stattdessen bekommen die Hörer wieder Tiktok-Happen serviert. Tyler bleibt sich mit diesem Album treuer, als es erst einmal den Anschein hat.
Ein anderer Punkt ist, dass Tyler selbst sehr viel zu der Kultur beigetragen hat, die er jetzt mit diesem Album kritisiert. Er produziert mittlerweile Designer-Kleidung zum Angeben, deren Teile zwischen 300-1.500$ kosten und war in den Anfängen von Odd Future der Prototyp eines Influencers, der sehr viele alltägliche Momente seines Lebens abgefilmt und hochgeladen hat. Die Visualität seiner Musik war immer eine wichtige Säule seines Schaffens, in manchen vielleicht sogar wichtiger als die Musik selbst. Jetzt seinen Zuschauer ihre eigene Möglichkeit zur Visualisierung ihres Lebens nehmen zu wollen, klingt dann auf den zweiten Blick doch eher wie von oben herab.
Das Album macht grundsätzlich Spaß und vermittelt aufgrund der bewusst simpel gehaltenen Lyrics und der roh klingenden Produktion, die fast schon in Richtung Lo-Fi geht, definitiv den Eindruck, als habe Tyler nach Chromakopia und CMIYGL sich einfach mal auf einer halben Stunde Laufzeit austoben wollen, ohne danach noch ewig am Endergebnis rumzutüfteln. Angesichts der kurzen Wartezeit ist es ohnehin verwunderlich, dass es bereits dieses Jahr ein neues Album mit 10 Songs gibt. Gründsätzlich freue ich mich auch über jedes neue Tyler-Album. Dennoch werde ich das Gefühl nicht los, dass mit etwas mehr zeitlichem Abstand mehr drin gewesen wäre. Die Songs gehen teilweise nicht mal 3 min und viele Melodien kommen mir seltsam vertraut vor, so als hätte er die so oder so ähnlich auf den Vorgängeralben schon einmal verwendet. Vielleicht ist das hier ein Übergangswerk und wir bekommen nächstes Mal ein richtiges Dance-Album von ihm, aber irgendwie fehlt es mir bei diesem hier an längeren Songs (wurde von meinem Vorredner ausführlich angesprochen) und einer ausgefeilteren Produktion. Dass er es kann, wissen wir, daher 3/5.