laut.de-Kritik
Eine lyrische Intensität jenseits irdischer Maßstäbe.
Review von Toni HennigDass der am 23. August 1947 in Oslo geborene Musiker und Komponist Terje Rypdal ein "Rubato-Interesse für Tonfarben und Dynamik" besitzt, "das häufig nach der klassischen Welt duftet", hatte schon einmal der britische Kritiker und Poesieprofesser Michael Tucker hervorragend auf den Punkt gebracht. Das hört man schon in "Darkness Falls", dem Opener seines im Sommer 1975 aufgenommenen Meilensteins "Odyssey", wenn er immer wieder sein Instrument laut anschwillen lässt, aber auch scharfe Umrisse und Konturen zeichnet, versehen mit einer gehörigen Prise Rock-Pathos.
Zu diesem Pathos fand der "Klangpoet an der Fender Stratocaster" erst recht spät, nämlich im Titelstück des ein Jahr zuvor veröffentlichten Vorgängers "Whenever I Seem To Be Far Away", das zusammen mit dem Stuttgarter Südfunk-Sinfonieorchester entstand. Das zeigte Rypdal von seiner konventionelleren, klassischeren Seite in Anlehnung an große spätromantische Komponisten wie Gustav Mahler.
Aber genau dieser ungewöhnliche sinfonische Kontext half dem Norweger dabei, sein prägnantes Spiel nicht nur zu perfektionieren, sondern auf eine neue melodische Spitze zu treiben, wenn er sich immer wieder zu opulenten Streicher- und Bläser-Klängen zu ebenso schneidenden wie auch gefühlsbetonten Soli hinreißen ließ, die man mit einer typisch nordischen Stimmung assoziiert. Bis dahin war es jedoch ein langer Weg.
Der Sohn eines Militärkapellmeisters und Klarinettisten entwickelte jedenfalls schon von Kleinauf ein Interesse an Musik. Mit sechs bekam er Klavierunterricht. Mit zwölf kam er seinem Vorhaben recht Nahe, die zunehmend schwierigeren Stücke Franz Schuberts anzugehen. Da spielte er auch Saxofon, Flöte und für vier bis fünf Jahre während seiner Schulzeit Trompete. Für ihn war das "wirklich hilfreich als Komponist", fasste er in einem Gespräch zusammen. "Das ist, wer ich bin".
Mit dreizehn brachte Rypdal sich noch zusätzlich das Gitarrenspiel autodidaktisch bei. Seine erste Band, The Vanguards, hatte er schon als Teenager. Mit ihr stand er mit beiden Beinen im Rock'n'Roll, tourte aber auch mit Reggae- und Ska-Größen wie Jimmy Cliff und Millie Small. Ihre Musik sprach sich lokal sehr schnell rum. In gewissen Kreisen handelte man den Norweger damals als jungen Pop-Star.
Doch dann entdeckte er Jimi Hendrix für sich, der neben Cliff als Inspirationsquelle für seine eigene Band The Dream diente, mit der er sich mehr in psychedelischere Gefilde vorwagte. Die hob er zusammen mit Organist Tom Karlsen, Drummer Christian Reim und Bassist Hans Marius Stormoen 1967 aus der Taufe.
Der vielleicht wichtigste Einfluss für Rypdal waren allerdings die seriellen Klangflächen György Ligetis, mit denen er gerade in Berührung kam, als er für sich entschied, Berufsmusiker zu werden, zeitgleich zu seinem Studium der Komposition an der Universität Oslo und am Konservatorium bei Finn Mortensen.
Sein erstes Solo-Album "Bleak House", seinen Türöffner für den Jazz, brachte er 1968 auf den Markt. Auf der Platte hörte man auch zwei junge aufstrebende Talente des Genres, nämlich Saxofonist Jan Garbarek und Drummer Jon Christensen, die noch kurz vor der Bandauflöung zu The Dream gestoßen waren. Schon auf dieser Scheibe bemühte sich Rypdal um die Fusion unvereinbarer Elemente aus Jazz, Blues, Rock, Klassik und Pop. Zudem ließ sich sein unverwechselbarer Gitarrensound mit den bemerkenswerten Obertönen und sein melodisch lyrisches Verständnis bereits erahnen.
Garbarek und Christensen sollten sich jedenfalls Ende der 60er auch außerhalb Skandinaviens als feste Jazz-Größe etablieren, so wie auch Rypdal, der 1969 für eine von Lester Bowie geleitete Band beim Free Jazz Meeting Baden-Baden eigene Kompositionen beisteuerte und damit den internationalen Durchbruch schaffte.
Ab 1970 war der Osloer fester Bestandteil des Münchener Labels ECM, dem er nach wie vor die Treue hält. Da gehörte er schon zur Band Jan Garbareks, in der er als Gitarrist nach und nach zu einer eigenen melancholischen Klangsprache fand, die aber durchaus seinen Vorbildern geschuldet war. Des Weiteren entwickelte er durch den freejazzigen Ansatz des Saxofonisten auf "Afric Pepperbird" von 1970 und "Sart" von 1971 ein besonderes Gespür für Improvisation.
Für die letztgenannte Platte schrieb er sogar eigene Stücke, die bis auf "Lontano" allerdings keine Verwendung fanden. Deswegen schlug Labelchef und Produzent Manfred Eicher dem Gitarristen vor, ein eigenes Werk für das Label einzuspielen. Trotzdem vernahm man auf seinem selbstbetitelten ECM-Debüt, auf dem er mehr jazzrockige Töne in Anlehnung an John McLaughlin anschlug, die selbe Besetzung wie auf dem nur wenige Monate zuvor erschienenen "Sart", nur ergänzt um seine damalige Ehefrau Inger Lise Rypdal am Mikro und Ekkehard Fintl an der Oboe.
Jedenfalls klangen seine Saiten-Töne auf der Scheibe oftmals wie ein brodelnder Vulkan kurz vor dem Ausbruch. Die atmosphärischen Versatzstücke nach dem Vorbild Ligetis vernachlässigte er trotzdem nicht. Auf dem Nachfolger "What Comes After" (1974), der mit Oboen- und Horn-Sounds mehr Anklänge an die norwegische Natur besaß, wurde sein Spiel immer mehr zum reinen Klang. Dabei blieb von der ursprünglichen Besetzung nur noch Jon Christensen übrig. Auf dem Album gab zudem der E-Bassist Sveinung Hovensjø sein Stelldichein in Rypdals Band. Der blieb auf "Odyssey" auch die einzige verbliebene Konstante im Line-Up.
Letzten Endes verschiebt Hovensjø auf "Odyssey" mit seinem einfachen, prägnanten Spiel das Soundbild oftmals in Richtung Rock. Aber auch die weiteren Musiker auf der Platte haben sich einen Teufel um konventionelle Jazz-Strukturen geschert. Das Line-Up kam 1975 zusammen, nachdem Rypdal zuvor mehr oder weniger "kurzlebige Trios" bildete, die er "für Tourneen" zusammenstellte. Eigentlich wollte er ja den Mellotronisten und E-Pianisten Pete Knudsen für die Aufnahmen gewinnen, der auf dem Vorgänger mitwirkte, aber der hatte schon "andere Pläne". So entschied er sich für eine recht ungewöhnliche Besetzung aus unbekannten Musikern aus seiner Heimat. Im Großen und Ganzen die wohl beste Entscheidung seiner Karriere.
Gerade der psychedelische Ansatz des Organisten Brynjulf Blix und die rhythmische Komplexität des Drummers Svein Christiansen haben einen großen Anteil daran, dass "Odyssey" einen besonderen Stellenwert in der Diskografie des Gitarristen einnimmt. Als ziemlich außergewöhnliches Bindeglied zwischen den einzelnen Musikern fungiert jedoch Posaunist Torbjørn Sunde, der immer wieder schöne solistische Akzente von naturhafter Urwüchsigkeit setzt. Und auch Rypdal hört man an, dass er sich keinesfalls davor fürchtet, gewohnte Pfade zu verlassen, entfaltet sich die Magie seines Spiels nicht nur ausschließlich an der Gitarre, sondern auch erstmalig am Sopran-Saxofon und am Synthesizer.
"Odyssey" markierte auch den Beginn seiner Fokussierung auf geschichtete Kompositionen in Kombination mit einer Formation, für die Improvisation elementar war. Dabei schrieb er "Musik in zwei Schichten". "Bass und Drums" als Unterbau bildeten die eine, das darüber geschichtete Rubato-Spiel die andere. Im Grunde hatte er versucht, "den Komponisten und die Spieler" vermehrt in Übereinstimmung zu bringen.
Als Paradebeispiel dient "Midnite", wo der Osloer zum ersten Mal seinen Schichtungen den nötigen Raum zur Entfaltung lässt. Immer wieder umschmiegen seine Saxofon-Soli im Wechsel mit Sundes erdverbundenem Spiel repetitive Bassläufe, nächtlich sphärische Orgel-Klänge und kraftvoll elastisches Schlagzeug. Dazwischen steigen auch mal flächige Keyboard-Töne in den Nachthimmel auf.
So ab Minute 10 ragen aus dem Nichts orchestrale Sounds der Fender Stratocaster empor, die Rypdal immer wieder dehnt. Gegen Ende lodert es geradezu energetisch, so wie bei Jimi Hendrix, was aber nie in reinen Rock-Attacken ausufert. Vielmehr scheinen die von John Coltranes "Meditations" beeinflussten Improvisationen geradezu ätherisch vor sich hinzufließen.
Rockig darf es trotzdem hier und da mal sein, etwa wenn Hovensjø in "Better Off Without You" mit seiner fuzzbetonten Bass-Arbeit die Führung übernimmt oder wenn sich die einzelnen Musiker in "Over Birkerot" in verspielte und treibende Miles Davis-Fusion-Sphären begeben, immer wieder durchkreuzt von emporsteigenden Posaunen-Klängen, die wahrlich ganze Naturgewalten heraufbeschwören. Ansonsten lebt das Werk größtenteils von ruhigen sinfonischen Ansätzen und einer unbeschreiblichen Mystik sowie einer impressionistischen Bildhaftigkeit, die sich auch im ursprünglichen 70er-Jahre-Soundbild niederschlägt, das sowohl einige Kritiker als nicht mehr zeitgemäß bemängelten als auch einige Jazz-Kenner als zu esoterisch empfanden. Die unglaubliche Schönheit, die den atmosphärischen Klanglandschaften auf dieser Platte innewohnt, könnte durch den authentischen Charakter der Aufnahme dennoch kaum besser zur Geltung kommen.
Man muss nur das mehr der Polytonalität und Mikropolyphonie Ligetis als den veränderbaren Harmonien des Jazz' geschuldete "Adagio" hören, um in unendlichen Sphären zu schweben, die man am liebsten nie wieder verlassen möchte. Da erzeugt nämlich die schwirrende Orgel eine Weite, die Sunde und Rypdal genug Spielraum gibt, mit ihren Soli eine lyrische Intensität zu erzielen, die sich mit irdischen Maßstäben kaum mehr messen lässt.
"Fare Well" hat dagegen mehr etwas von den Klangflächenkompositionen Krzysztof Pendereckis, zumal Blix' streicherähnlicher Ansatz eine beklemmend düstere Dramatik entwickelt, die als Voraussetzung dafür dient, dass der Dialog zwischen Gitarre und Posaune gegen Mitte seine schwermütige Wirkung erzielt. Zum Schluss schwebt die Fender Stratocaster klagend in die Nacht empor.
Da weist "Ballade" schon fast sowas wie eine songähnliche Struktur auf, wenn sich über druckvolle Drums tranceartige Orgel-Klänge und hymnische Posaunen- und Gitarren-Soli legen, die sich ständig in Bewegung befinden. Genauso flexibel agiert das Quintett im abschließenden "Rolling Stone", das vor allem in Deutschland eine gewisse Popularität erreichte. "Wenn wir es" damals "nicht gespielt" hätten, wären wir "ausgebuht" worden, so der Osloer im Nachhinein.
Und wenn man nach einem schwindligen Orgel-Intro ein markantes 4/4-Motiv am Bass ertönt, das sich die nächsten rund zwanzig Minuten überhaupt kein einziges Mal verändert, weiß man warum. Denn mehr Rock im Jazz geht beinahe nicht mehr, was das dynamische Schlagzeug und die wabernde Orgel nur noch weiter verstärken. Unabhängig davon unterscheidet sich die Nummer gar nicht mal so sehr von den restlichen Stücken, fokussiert sich Rypdal größtenteils auf seine Rubato-Themen. Die spult er aber keineswegs all zu souverän und routiniert ab. Vielmehr erzählt er mit seinen langen, aber nie ausschweifenden Soli sowas wie eine ganze Erlösungsgeschichte.
So tönen seine Improvisationen oftmals nahezu flehend, aber auch brodelnd und kraftstrotzend, jagen von einem kathartischen Moment zum nächsten. Kurz vor Erreichen der 20-Minuten-Grenze verhallt die Gitarre schließlich erst einmal nachdenklich im Nichts. Es erschallen Posaunenklänge, die inbrünstig die Götter anrufen. Der Bass zieht die Lautstärke noch einmal an. Danach erklingt ein weiteres Mal die Fender Stratocaster, nur ungleich erdiger, bis die Töne des Osloers bedächtig abebben. Sie ruhen nun völlig in sich. Milde kehrt ein.
Lange Zeit hat es das Stück nicht auf eine offizielle CD-Version des Albums geschafft, da es schlichtweg das CD-Format gesprengt hätte. Bis 2012, als ECM mit "Odyssey: In Studio & In Concert" das Werk als opulentes Box-Set wieder veröffentlichte, ergänzt um eine damals frisch ausgegrabenen Radio-Aufnahme vom Juni 1976 mit der Swedish Radio Jazz Group.
Die trägt den Namen "Unfinished Highballs" und entstand fast in der identischen Besetzung wie "Odyssey", erweitert um eine Big Band. Nur Sunde, der schon bei den Tourneen davor nicht mehr dabei war, wirkte bei dieser Einspielung nicht mit. Jedenfalls wirft sie auf Rypdals Herangehensweise an orchestrale Kompositionen ein ganz neues Licht, verschmelzen doch die feierlichen Bläser mit seinen Rubato-Themen und der sowohl geduldigen als auch dynamischen Vorgehensweise seiner Formation selbstverständlicher als das großangelegte Konzept den Anschein hat. Auf jeden Fall lohnt sie jeden einzelnen Cent und gehört mit zum beeindruckendsten in der Karriere des Norwegers.
Der "Klangpoet an der Fender Stratocaster" nahm danach noch eine Menge großartige, ja sogar wegweisende Musik auf, wie etwa "Chaser", das 1985 erschien. Ab den 90ern trat er zunehmend als Komponist klassischer Werke in Erscheinung, worunter auch das 2002 veröffentlichte "Lux Aeterna" zählt, über das Thom Jurek von Allmusic sogar schrieb, dass es die größte "Musik seines Lebens" sei.
Dreh- und Angelpunkt seiner Diskografie bildet trotzdem "Odyssey", für das er noch im selben Jahr seiner Entstehung den Deutschen Schallplattenpreis erhielt. Der reine Klang und Tonfall Bill Frisells? Die melancholisch weiträumigen Soundsphären Eivind Aarsets? Die emotionale Vielschichtigkeit David Torns? Die folkloristische Mystik Raoul Björkenheims? Ohne die grandiose Vorarbeit Rypdals und seiner Band auf diesem Werk wohl kaum vorstellbar.
In der Rubrik "Meilensteine" stellen wir Albumklassiker vor, die die Musikgeschichte oder zumindest unser Leben nachhaltig verändert haben. Unabhängig von Genre-Zuordnungen soll es sich um Platten handeln, die jeder Musikfan gehört haben muss.






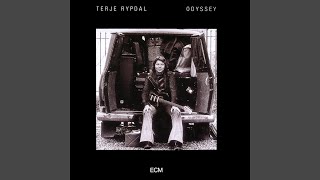



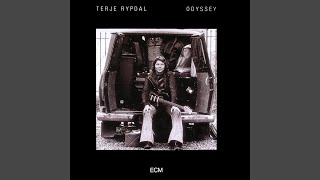


2 Kommentare
Geschmackssache. Für mich gehts so. 3/5.
Danke für den großzügigen Artikel, das Werk hat es verdient.