laut.de-Kritik
Der Mann der alles kann, scheitert an den eigenen Ambitionen.
Review von Mirco LeierObwohl Donald Glover, aka Childish Gambino, in den vergangenen Jahren so gut wie nie aus der Öffentlichkeit verschwunden war, fühlte sich die vierjährige Wartezeit auf "3.15.20" scheinbar endlos an. Nachdem er mit "Atlanta" "Twin Peaks" in die Hauptstadt des Trap holte, mit "Awaken My Love!" einen musikalisch-radikalen Neo-Soul-One-Eighty vollzog und auf "Guava Island" mit Rihanna gen Sonnenuntergang tanzte, war endgültig klar: Es gibt tatsächlich nichts, was der Mann nicht kann. Umso interessanter und brennender also die Frage, wie sein nächstes und voraussichtlich letztes musikalisches Outing wohl klingen mag.
Ein Blick auf den Titel, das Cover und die Tracklist lassen ahnen, dass Glover sich erneut noch höhere, verrücktere Ziele steckt als zuvor. Wo die Konzepte und Aufmachungen seiner beiden vorherigen Alben opulent, durchdacht (mal mehr mal weniger) und vollkommen wirkten, springt einem bei "3.15.20" ein artsy-fartsy Minimalismus ins Gesicht, der sich zumindest teilweise auch in musikalischer Hinsicht bestätigt.
So erzeugt die Instrumentierung im Zusammenspiel mit der freien Form der Songstruktur und der oft unsauberen Abmischung immer wieder eine Lo-FI Ästhetik, die man jedoch auch weniger schmeichelnd als unfertig bezeichnen könnte. "3.15.20" sieht nicht nur aus wie ein namenloses Demo-Tape, es hört sich leider auch bisweilen danach an.
Gambinos raketenartige Progression vom "Community"-Rapper zum Stern am Pop-Rap-Himmel, zum Soul-Wiederbeleber ist zwar mehr als beeindruckend, wirft aber auch die Frage auf, ob er den einzelnen Stationen seiner Karriere vielleicht ein wenig mehr Zeit hätte schenken sollen. Blickt man auf seinen bisherigen Projekte zurück, so zeigte das kalifornische Wunderkind neben jeder Menge kreativen Geniestreichen eben auch viel ungenutztes Potenzial.
Alle Stationen dieser Entwicklung kommen nun in "3.15.20" zusammen: Ein Album, das es trotz der Fülle an Ideen nur selten schafft, besagtes Potenzial abzurufen. All die Probleme, mit denen vergangene Gambino-Projekte kämpften, finden sich auch hier, nur eingebettet in ein wesentlich experimentelleres und unstrukturierteres Klangbild.
Oft hat man das Gefühl, als versuche Glover, seine Ideen so out-there und unkonventionell wie möglich zu verpacken, um sich so fast schon selbst dazu zu zwingen, sich noch mal neu zu erfinden. Dabei erreicht er nie die Qualität jener Künstler, an deren Sound er sich orientiert. Das Intro "0.00" beispielsweise erinnert mit seiner psychedelischen Verträumtheit an einen gelangweilten Travis Scott auf Autopilot."32.22" klingt währenddessen nach einem besonders radikalen "Yeezus"-Outtake und wirkt, flankiert von zwei der souligsten Songs der LP, wie ein Fremdkörper.
Auf Songs wie "24.19", "19.10" oder "47.48" versucht er mit fast schon an Ambient grenzenden minutenlangen Outros, eine cineastische Ebene zu erreichen, die aber weder kohärent noch musikalisch interessant ist. Man wartet gespannt auf den Pay-Off eines langen atmosphärischen Build-Ups, wird aber letztlich nur mit einem mal mehr mal weniger sauberen Übergang in den nächsten Track belohnt.
Was nicht heißen soll, dass die Songs per se schlecht sind. Gerade "19.10" hat einen unwiderstehlichen Groove, und "12.38" ein großartiges 21 Savage-Feature, aber sie schaffen es eben nicht, die Qualität über die komplette Laufzeit oben zu halten.
Dafür tragen keineswegs die erwähnten Outros die Verantwortung. Gleichgültig, ob die musikalische Umsetzung eines Drogentrips ("12.38"), oder das Thema Klima im Ariana Grande-Duett "Time": Glovers Ideen, so ansprechend sie anfangs auch sein mögen, schaffen es weder lyrisch noch musikalisch, den Hörer fünf, geschweige denn sieben Minuten bei Laune zu halten.
Am besten ist die Platte in jenen Momenten, in denen sich Glover auf das Wesentliche beschränkt, und seine Vision ohne große Schnörkel präsentiert. "Alghorythm" konterkariert trostlose Lyrik und ein metallenes, synthlastiges Klangbild mit einem infektiösen Dance-Chorus. Die bereits 2018 veröffentlichte Single "42.26" (aka "Feels Like Summer") kombiniert die psychedelischen und souligen Elemente zu einem melancholischen, aber dennoch tanzbaren Sommersong mit doppeltem Boden, und der Closer "53.49" gibt Gambinos Stimme, die er hier in fast geschriener James Brown-Marnier zu Schau stellt, reichlich Raum zu glänzen.
Als finales Album wirkt "3.15.20" gleichermaßen wie ein logischer Schlussstrich und eine herbe Enttäuschung. Glover bringt zwar all seine Talente in diesen potentiell großartigen Tonträger ein, tanzt so aber meistens auf zu vielen Hochzeiten. Letzten Endes scheitert er an seinen eigenen Ambitionen: Es soll viertes Studioalbum, Konzeptalbum, Comedy, Soul-Worship, Hip Hop, Ambient und noch viel mehr zugleich sein.
Was jetzt noch bleibt, ist die Hoffnung auf eine dritte Staffel "Atlanta" und die etwas beruhigende Erkenntnis, dass selbst der Mann der scheinbar alles kann, nicht davor gefeit ist, den Mund zu voll zu nehmen. Alles andere wäre auch langsam unheimlich geworden.



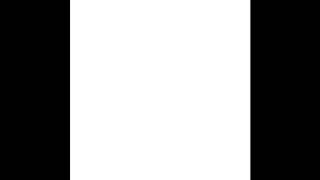


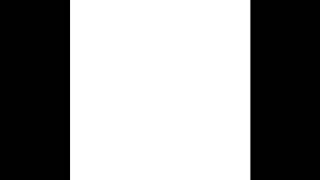


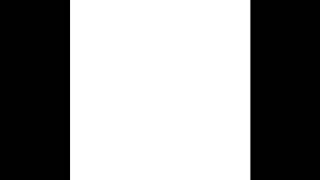

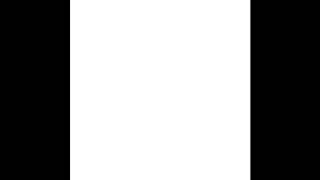

3 Kommentare
Der Glover ist schon in allem gut, was er macht. Ich glaube nicht, daß er seine Talente zu weit verstreut hat.
Auch Glovers "schlechtestes Album" ist immernoch ne solide 4. Mehr muss man denk ich nicht sagen.
Ich finde das Album sogar richtig gut. Klar ist es nicht so gut wie Because the Internet aber es hat immer noch einen eigenen Vibe.